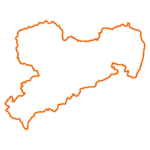2017 erschien die letzte Auflage der Autobiografie „Ernst Hirsch – Das Auge von Dresden“, in der sich der bekannte Dresdner Kameramann und Filmemacher Ernst Hirsch seiner Lebensgeschichte widmet. Das Buch war schnell ausverkauft und ist heute auch auf dem antiquarische Buchmarkt nicht mehr zu haben. Exklusiv gestatte Ernst Hirsch unserem Portal „leben50“ eine Veröffentlichung. Nach Vorfahren, Eltern und seiner Kindheit widmet sich Ernst Hirsch in seiner Autobiografie „Ernst Hirsch – Das Auge von Dresden“ in unserem Teil 5 seiner Schulzeit:
„Ernst Hirsch – Das Auge von Dresden“ – Schulzeit
1942 kam ich in die Schule. Die Eltern, Verwandte und Freunde begleiten mich am ersten Schultag zur 9. Volksschule am Georgplatz. Die Schule hatte getrennte Eingänge für Mädchen und Knaben. Das Klassenzimmer lag im Erdgeschoss und durch die Fenster sah man auf die Kreuzschule nebenan. Wir schrieben noch mit dem Griffel auf die Schiefertafel, zum Auswischen diente ein kleiner feuchter Schwamm, der aus dem Ranzen heraushing.
Schon nach einigen Tagen ging ich allein in die Schule bis zum Georgplatz, zuerst entlang der Johann-Georgen-Allee, dann bog ich links ab in die Carusstraße, die Borngasse war sehr kurz und mündete auf die Johannesstraße und schon war ich an der Schule angelangt – keine 10 Minuten. Ein gefahrloser Schulweg, keine Hauptstraße musste ich überqueren. Im ersten Haus der Borngasse wohnte im obersten Stockwerk ein Schulkamerad, den ich manchmal abholte. Aus seinem Wohnzimmerfenster sah man die große Uhr am Rathausturm. Vom Fenster aus schien sie mir besonders groß und ich beneidete die Leute, sie hatten ständig die genaue Zeit in Sichtweite vor sich und brauchten keine eigene Uhr.
Ein anderer Schulkamerad wohnte mit seinen Eltern Eltern in einem Seitengebäude des Hygiene-Museums, welches ich auf diese Weise auch von innen kannte.
Wie lernten wir die Buchstaben schreiben? Genau daran erinnerte ich mich, wie uns der Lehrer das kleine f erklärte: Herr Uhlig zog eine Linie an der Wandtafel, und darauf saß ein stilisierter Vogel ähnlich dem Buchstaben, seine Füße sollten der Querstrich in der Mitte sein.
Trotz der engen Bebauung der Innenstadt war hinter der Schule zur Carusstraße hin ein großer, gepflegter Schulgarten, in dem die Schüler über botanische Kenntnisse erwarben.
Bis zum Frühjahr 1944 besuchte ich die 9. Volksschule. Am 7. Februar 1944 erhielten wir letztmalig in dieser Schule die Zensuren. Der Krieg dauerte nun schon fast 5 Jahre, aber das tägliche Leben in Dresden schien, zumindest für uns Kinder, wie gewohnt zu verlaufen. Doch Luftschutzübungen nahmen zu und die Furcht vor Bombenangriffen wuchs. Schließlich wurden alle Schulen geschlossen und die Kinder aufs Land geschickt.
Meine Eltern mieteten in Eschdorf im Schönfelder Hochland beim Bauern Paul Sommer eine sogenannte Auszugswohnung. Wegen der zu befürchtenden Luftangriffe lagerten sie Möbel, Wäsche und wertvolle Gegenstände dorthin aus und im Frühjahr 1944 zog auch ich, betreut von meiner Großmutter, dort ein. Ein Datum hat sich mir fest eingeprägt, es ist der 4. April 1944. Für die tägliche Milchablieferung, die Kühe wurden noch mit der Hand gemolken, mussten sogegenannte Milchkarten an den Kannen befestigt werden, damit man in der Molkerei wusste, von welchem Bauern mit wie viel Litern Inhalt die betreffende Kanne stammte. Ich schrieb auf die Karten das Datum und den »Vierten-Vierten-Vierundvierzig« merkte ich mir. Es ist das erste Datum, welches ich fest im Gedächtnis trage.
Dort in Eschdorf ging ich in die Dorfschule. „Ernst Hirsch wurde aus Dresden evakuiert“, steht unter den Zensuren, welche der Klassenlehrer Willy Funke am 10. Juli unterschrieb. Mehrere Klassenstufen wurden in einem Klassenraum unterrichtet und Kantor Funke hatte den Rohrstock schnell mal zur Hand oder ließ einen Schüler zur Strafe in der Ecke stehen. Seine große blaue Nase hat sich mir eingeprägt. Aber er war ein guter Lehrer für Generationen Eschdorfer Schüler. In der Dorfkirche neben der Schule spielte er am Sonntag die Orgel, deren Prospekt Gottfried Semper entwarf.
Auf dem Friedhof befindet sich das Grab der Eltern des Dresdner Hofmühlenbesitzers Traugott Bienert, der aus Eschdorf stammte, später ein bekannter Gönner und Kunstmäzen in Dresden. Zusammen mit anderen Schülern besuchte ich den Gottesdienst. Zur Kirchweihe wurden bei den Bauern große Kuchen gebacken, die in Stücke geschnitten und übereinander geschichtet auf den Tisch kamen. Auf dem Dorf spürte man die Lebensmittelknappheit nicht so sehr, waren doch die Bauern sogenannte »Selbstversorger«. Sie lieferten Getreide in die Mühle und das Mehl dann zum Bäcker Hübner im Unterdorf. Dort konnten die Bauern dann Brot ohne Lebensmittelkarte beziehen. Wenn ich zum Bäcker geschickt wurde, reichte mir die beleibte Bäckersfrau ein großes rundes Brot über den Ladentisch und strich es im Kontingent des Bauern an. Jeden Morgen gab es eine Milchsuppe, in die Brot eingebrockt war. Der Gutshof nebenan gehörte dem Bauern Paul Gierth, mit dem sich meine Eltern anfreundeten.

Während dieser Zeit auf dem Dorf lernte ich viel vom bäuerlichen Leben kennen, das noch völlig traditionell geprägt war. Pferdegespanne zogen die Ackergeräte, den Pflug, die Sämaschine oder die schweren Wagen, die mit Heu, Getreidegarben, Kartoffeln oder Rüben beladen waren. Die Garben, mit der Hand gebunden und zu Puppen aufgestellt, wurden in der Scheune „eingepanselt“, wo sie im Winter, allerdings nicht mehr mit dem Dreschflegel, sondern schon mit einer Dreschmaschine gedroschen wurden. Im Stall standen sechs Kühe, und die Schweine lagen im Koben. Am Wochenende kamen meine Eltern zu uns, mein Vater war nicht zum Kriegsdienst eingezogen worden. Eschdorf war von Weißig aus mit der Eisenbahn oder auch zu Fuß leicht zu erreichen.
Im Winter 1944 hatte es viel geschneit und zu Fahrten in der Umgebung spannte der Bauer Paul Gierth den Kutschschlitten an. Vorgeheizte Ziegelsteine wärmen die Füße der Fahrgäste, die sich mit Pelzen zudecken. Eine der Fahrten ging zur nahegelegenen Dittersbacher „Schönen Höhe“. Ich setzte mich hinten auf den schmalen „Dienersitz“, von dem man, wenn die Fahrt langsamer bergan ging, auch mal abspringen und nebenher laufen konnte. Das Schellengeläut der Pferde klang durch den Wald und oben am Aussichtsturm, den der einstige Gutsbesitzer Johann Gottlob von Quandt 1833 bauen ließ, gab es ein heißes Getränk. Das Leben im Dorf verlief noch in gemächlichen Bahnen. Im Winter trafen sich die Frauen jeweils wöchentlich in einem anderen Gutshof zum Federnschleißen. In den ungeheizten Schlafkammern war ein dickes Federbett willkommen, als Matratze diente ein dicker Strohsack, der hin und wieder neu gestopft wurde.
So vergingen die Tage und Wochen bis zum Beginn des Jahres 1945, welches für uns alle die Katastrophe bringen sollte.
Mehr von und über Ernst Hirsch
In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann lesen Sie, wie Ernst Hirsch den Bombenangriff auf Dresden erlebt hat.
Das vorangegangene Kapitel über die Kindheit von Ernst Hirsch können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.
In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.