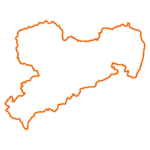Im Freistaat Sachsen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 123 Erkrankungen an behandlungsbedürftiger Lungen-Tuberkulose gemeldet. Damit stieg die Fallzahl gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent an. Die sächsischen Fallzahlen aus 2024 bedeuten: Pro 100 000 Einwohner wurden 3,0 Lungentuberkulosen diagnostiziert. Trotz des Anstiegs liegt Sachsen weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt von 3,6 pro 100.000 Einwohner im Jahr 2022. Insgesamt wurden zum Stichtag 1. März 2025 dem Robert Koch-Institut 4.391 Erkrankungen an Tuberkulose (TBC) gemeldet.
Gesundheitsministerin Petra Köpping warnt: „Auch, wenn Deutschland zu den Industrienationen gehört, in denen keine Hochinzidenzwerte erreicht werden, so ist Tuberkulose noch immer mit Herausforderungen verbunden. Dank frühzeitiger Diagnoseverfahren und wirksamer Therapien ist Tuberkulose heute behandelbar. Dennoch darf die Bedeutung einer umfassenden Prävention nicht unterschätzt werden. Der Freistaat Sachsen unterstützt die Gesundheitsämter und das medizinische Fachpersonal dabei, Infektionen frühzeitig zu identifizieren und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.“
Die COVID-19-Pandemie hatte in weiten Teilen der Welt und vor allem in den Hochinzidenzländern einen deutlich negativen Einfluss auf die Entwicklung, Verbreitung und Bekämpfung der Tuberkulose. Fallfindungsraten sanken, notwendige Behandlungen wurden verzögert.
In den letzten Jahren sind die Fallzahlen von Tuberkulose in Deutschland stabil geblieben. Dennoch bleibt Wachsamkeit geboten, da globale Entwicklungen, Migration und resistenzentwickelte Erreger die Bekämpfung erschweren. Besonders wichtig ist die frühe Erkennung und rasche konsequente Behandlung der Erkrankung, um ihre weitere Verbreitung einzudämmen.
Herausforderungen im Kampf gegen Tuberkulose sind das Fehlen effektiver Impfstoffe sowie das Auftreten multiresistenter Erreger. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) engagiert sich in der Entwicklung neuer Wirkstoffe und Behandlungsstrategien.
Weitere Forschungsansätze des DZIF konzentrieren sich auf die frühzeitige Erkennung von Antibiotikaresistenzen und die Entwicklung personalisierter Behandlungsstrategien. Internationale Kooperationen unterstreichen die Bedeutung globaler Zusammenarbeit im Kampf gegen Tuberkulose.
Professorin Dr. Anna Kühne forscht im Uniklinikum Dresden zu Tuberkulosebehandlungen in der Bevölkerung sowie auch zur Prävention und Aufklärung. Sie bestätigt: „Die Behandlung von Patienten mit Tuberkulose ist komplex und stellt das öffentliche Gesundheitswesen vor erhebliche Herausforderungen. In Deutschland sind im Jahr 2024 knapp 4.400 Patientinnen und Patienten mit Tuberkulose gemäß Infektionsschutzgesetzgemeldet worden; zudem ist die Anzahl der Fälle mit arzneimittel-resistenter Tuberkulose über die vergangenen drei Jahre bundesweit eher gestiegen. In Sachsen sind die Erfolgsraten der Tuberkulose-Therapie weiterhin besonders hoch. Das ist nur möglich durch die gute Arbeit der niedergelassenen Ärzte sowie der umfangreichen Unterstützung von Patienten und Versorgenden durch die Gesundheitsämter.“
Prof. Dr. Dirk Koschel, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Pneumologie am Lungenzentrum Coswig und Bereichsleiter Pneumologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden betont: „Prinzipiell können Patienten mit Tuberkulose, auch solche mit multiresistenten Formen, durch neue Medikamente und Behandlungsstrategien gut behandelt werden, aber andere Begleiterkrankungen der betroffenen Patienten wie z.B. HIV-Infektion, aber auch soziale Ko-Faktoren können immer wieder große Herausforderungen darstellen. Gerade dann ist es wichtig, dass Klinik, niedergelassene Ärzte und der öffentliche Gesundheitsdienst eng zusammenarbeiten um langfristig den Therapieerfolg zu erwirken.“
Der Welt-Tuberkulose-Tag am 24. März mahnt, die Anstrengungen zur Eindämmung dieser tödlichen Infektionskrankheit zu verstärken und innovative Forschungsansätze zu fördern. Nur durch Aufklärung, Forschung und einer effektiven medizinischen Versorgung kann das Ziel einer tuberkulosefreien Zukunft erreicht werden. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Die Zahl der Neuerkrankungen bis zum Jahr 2035 auf weniger als 1 pro 100.000 Einwohner zu senken.
Hintergrund:
Tuberkulose ist eine von einem Bakterium hervorgerufene Infektionskrankheit und findet sich überall auf der Welt. Sie wird mittels Tröpfchen über die ausgeatmete Luft, die insbesondere beim Husten und Niesen von erkrankten Personen freigesetzt wird, übertragen. Wenn ein TBC-Fall festgestellt wurde, muss schnell und sorgfältig ermittelt werden, wo die Ansteckung erfolgte und ob auch weitere Personen infiziert worden sein könnten. Diese Kontaktpersonen müssen dann über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Für Erkrankte ist die regelmäßige Einnahme hochwirksamer Medikamente wichtig. Besondere Probleme bereiten international die Erkrankungen an Tuberkulose, die durch resistente Erreger verursacht werden, gegen die mehrere der bewährtesten und erfolgreichsten Medikamente nicht mehr wirksam sind. Der Anteil multiresistenter Tuberkulosen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren angestiegen und lag 2022 bei 6 Prozent. In Sachsen schwankte der Anteil multiresistenter Tuberkulosen in den letzten Jahren und betrug bisher maximal 7 Prozent, aktuell lag er jedoch sogar bei ca. 9 Prozent.
Wertvolle und sehr gut aufbereitete Informationen zur Tuberkulose für Patienten und Ärzte auch in mehreren Sprachen werden durch das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose unter www.dzk-tuberkulose.de/patienten/ bereitgestellt. Sie können sich auch online unter www.lungeninformationsdienst.de informieren. Wegen der niedrigen Fallzahlen wird eine BCG-Impfung (Bacillus Calmette-Guérin, benannt nach den Erfindern des Impfstoffes) seit 1998 nicht mehr von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen.
Am 24. März 1882 erklärte Dr. Robert Koch, er habe den Erreger der Tuberkulose entdeckt. Im Jahr 1905 wurde ihm für seine Entdeckung der Nobel-Preis verliehen. Noch heute nimmt die Tuberkulose weltweit einen wichtigen Stellenwert ein, der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranlasst, jährlich den 24. März als Welttuberkulosetag zu begehen.