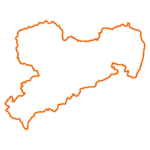Die Autobiografie „Ernst Hirsch – Das Auge von Dresden“ erschien 2016 – und ist längst vergriffen, auch die zweite Auflage. Selbst als gebrauchtes Exemplar ist die Lebensgeschichte des Dresdners nicht zu bekommen. Welch großes Glück, dass Ernst Hirsch „leben50“ einen exklusiven Nachdruck gestattet hat. Lesen Sie hier aus dem das Kapitel „Familie und Kindheit“ die ersten Abschnitte.
Als Neunjähriger sah ich meine Stadt in Trümmer sinken
Schlesische Vorfahren
Zu den wenigen überlieferten Urkunden unserer Familie gehört die Geburtsurkunde meines Urgroßvaters Friedrich Ernst Hirsch, der am 11. September 1845 im Dorfe Nieder-Tschirnau in der Preußischen Provinz Schlesien als Sohn des Freigärtners David Hirsch geboren wurde. Freigärtner gab es wohl nur in Schlesien. Sie waren Angehörige der dörflichen Mittelschicht und besaßen Haus, Hof und Garten, aber nur wenig Ackerland. Ihr Dienst für die Herrschaften bestand hauptsächlich in Handdiensten, Geldzins und Naturalabgaben. Wie heißt dieser Ort heute, wo liegt er und wie sieht es dort aus?
Mit meinen beiden Cousins Eberhard und Rudi begab ich mich im Juni 2004 auf Spurensuche. Über Görlitz und Bunzlau fuhren wir in Richtung Lissa. Der Ort, aus dem der Urgroßvater stammte, heißt heute Czernina und liegt 265 km von Dresden entfernt bei der Kleinstadt Gora, früher Guhrau.
Czernina ist ein ruhiges Landstädtchen. Es gibt nicht viel zu entdecken. Das Schloss, ehemals ein Stift adliger Fräulein, ist seit 1945 eine Ruine. Von der evangelischen Kirche, in welcher der Urgroßvater getauft wurde, steht nur noch der Turm.

Die katholische Kirche daneben ist gepflegt. Der Pfarrer Czeslaw Krochmal empfing uns freundlich und führte uns durch die Kirche und den Ort. Alle schriftlichen und sonstigen Erinnerungen an die Geschichte des Ortes werden heute in Gora aufbewahrt. Auf dem Friedhof fanden wir viele deutsche Namen auf den Grabsteinen. Das ehemalige große Kammergut ist nur noch in Teilen bewirtschaftet.
Wir fuhren weiter nach Peterswaldau am Eulengebirge. Dieser Ort heißt heute Piezyce. Von dort stammten die Schwestern Ernestine Heimlich, geboren am 22. Januar 1847 und Karoline Heimlich, geboren am 5. Juli 1845.
Karoline heiratete um 1870 Friedrich Ernst Hirsch aus Nieder-Tschirnau. Sie kamen, durch welche Umstände auch immer, nach Oranienburg zum Gut Friedenthal bei Sachsenhausen. Es war bereits im 18. Jahrhundert zur Seidenraupenzucht angelegt worden, und die Felder waren einst mit Maulbeerbäumen bepflanzt. Aus der Maulbeerplantage wurde ab 1805 das herrschaftliche Gut Friedenthal. Anstelle der Maulbeerbäume wurde ein Park angelegt. Die Besitzer wechselten: 1873 erwarb der Berliner Bankier Joseph Pinkuss das Gut. Dieser ließ ein schlossähnliches Gebäude im Stil der Zeit errichten und den Park erweitern.
Ein großer Pferdestall gehörte dazu und ein Familienhaus, in dem die Angestellten wohnten. Zu denen gehörte auch Friedrich Ernst Hirsch, der aus Nieder-Tschirnau gekommen war, mit seiner Ehefrau Karoline (geboren 1845) aus Peterswaldau. Am 31. März 1872 wurde mein Großvater Ernst Karl Emil Hirsch in Friedenthal geboren.
Es gab wohl auch noch einige Geschwister, ein Bruder des Großvaters lebte später in Berlin. Mein Großvater erzählte mir davon in einem Gespräch, das ich 1960 auf Tonband aufgezeichnet habe. Er ging in Oranienburg in die Schule. Es war ein weiter Schulweg entlang des Oranienburger Kanals bis zur Stadt. Der Kanal war ein vielbefahrener Transportweg, auch für durchlöcherte Kähne mit lebenden Fischen von der Ostsee. Es gab ja noch keine Kühlmöglichkeiten. Die Fische waren so dicht in die Kähne gepresst, dass man darauf stehen konnte. Bei Gewitter wurden die Kähne quer zur Fließrichtung des Kanals gestellt, damit sie reichlicher durchflossen wurden. Beim „Friedenthaler Kreuz“ begegneten sich der Oranienburger und der ältere Ruppiner Kanal, heute nur noch für den Wassertourismus genutzt. Großvater Ernst Karl Emil erzählte auch, wie er als Jugendlicher mit seinem Vater oft nach Ostpreußen gefahren ist, um dort für den Bankier und Gutsbesitzer Pinkuss junge Pferde, sogenannte Remonten, zu kaufen. Ich konnte mit dieser Bezeichnung nichts anfangen, aber Großvater wusste genau Bescheid. Es waren drei- bis vierjährige Pferde, die erst ausgebildet wurden. Darauf verstanden sich die Hirschs.
Das 19. Jahrhundert war ja noch die Zeit der Pferde. Allein das kaiserliche Heer hatte einen Bestand von 98.000 Pferden, die ständig ersetzt werden mussten. Nicht für das Militär taugliche Tiere kauften Fuhrwerksbesitzer für Transporte nach Berlin.
Das kleinste Pferd hieß Ella und gehörte zur Familie. Die Kinder spielten mit ihm. Es durfte manchmal mit ins Zimmer und soll sich sogar auf´s Sofa gelegt haben. Da hat Opa uns Kindern sicher etwas vorgeflunkert.
Der Oranienburger „Schützenwirt“ Emil Greiner musste eines Tages zu einem Notartermin nach Berlin und hatte den Zug verpasst. Das schnellste Pferd aus dem Friedenthaler Stall legte die 36 km lange Strecke bis Moabit in einer Stunde zurück. Der Wirt kaufte dem Urgroßvater den Hengst für 600 Goldmark ab.
Auf den Spuren der Vorfahren versuchten wir vor einigen Jahren auf der Rückfahrt von Hiddensee das Schloss Friedenthal zu finden. Es existiert heute nichts mehr davon. 1943 hatte der Sicherheitsdienst der SS dort eine Agenten- und Spionageschule unter Leitung des berüchtigten Otto Skorzeny eingerichtet. Nach Kriegsende wurden die Gebäude gesprengt. Nur der Pferdestall ist noch erhalten. In der Chronik von Oranienburg fand sich ein Foto davon.
Mit 24 Jahren kam Großvater 1896 nach Dresden. Die Stadt entwickelte sich in diesen Jahren zur Großstadt, es wurden viele Arbeitskräfte gebraucht. Sicher auch solche, die wie er, Erfahrung mit Pferden hatten und jung waren.
In Dresden war die Schwester seiner Mutter, Ernestine Heimlich (wir erinnern uns, sie kamen beide aus Peterswaldau) inzwischen mit Ernst Friedrich Hanztsch aus Gauernitz bei Meißen in Dresden verheiratet. Ernst war damals offenbar ein beliebter Vorname und auch ich wurde ja nach Urgroßvater, Großvater und Vater wieder Ernst genannt.
Die Hantzschs hatten eine Tochter, Elisabeth, gleichaltrig mit ihrem Cousin aus Oranienburg. Mit seiner Cousine hatte er, wie er in einem erhaltenen Tonbandprotokoll erzählt, ein „Verhältnis“. Sie waren beide 27 Jahre alt, als sie am 29. März 1899 in der Frauenkirche heirateten.
Als erstes Kind wurde mein Vater Ernst Walther Johannes Hirsch am 13. Februar 1900 geboren. Drei weitere Kinder folgten: Willy 1902, Rudolf und ein Mädchen – Charlotte.

Großvater Ernst Karl Emil Hirsch auf der Friesengasse in der Dresdner Altstadt
Gemeinsam mit meinem Vater besuchte ich oft den Opa. Wir gingen zu Fuß von der Johann-Georgen-Allee über die Johannesstraße, kreuzten die Ringstraße. Dann begann schon die Moritzstraße. Gleich nach der dichtbefahrenen Kreuzung König-Johann-Straße/Moritzstraße bogen wir rechts ab in die schmale Friesengasse. Sie führte zur Landhausstraße und ist als Straße heute noch erhalten. Auf der linken Seite standen schmale, ganz einfache Häuser aus der Barockzeit, vielleicht nach den Zerstörungen des Siebenjährigen Krieges auf alten Grundmauern wieder aufgebaut. Das Haus Nummer 1 hatte nur drei Fensterachsen. Im Erdgeschoss befand sich die Leihbücherei von Herrn Küster. Das Haus gehörte dem Uhrmachermeiste Emil Friedrich Kern, der vordem sein Geschäft dort hatte, ehe er auf die Moritzstraße umzog. Großvater wohnte im zweiten Stock. Die enge, gewundenen Treppe war nach der Dresdner Bauuordnung aus Sandsteinstufen gebaut. In einer Nische stand eine Petroleumlampe. In diesen Häusern gab es bis 1945 keine elektrische Beleuchtung oder Stromversorgung. Großvaters Wohnung bestand aus einer immer dunklen Küche, die nur ein Fenster vom Hausflur her hatte. Für die Wasserversorgung gab es im Treppenhaus einen Hahn mit Ausguss, einer sogenannten Gosse.
Ein „Abtritt“, wie man die Toiletten damals nannte, war wohl erst um 1930 für die Bewohner dieser Etage im Flur eingebaut worden. Bis dahin ging man im Hof in eine Bretterbude, auch Nachttöpfe waren noch gebräuchlich.
Vom Treppenflur aus kam man direkt in die Küche, dann ging es ins Wohnzimmer, das zwei Fenster hatte, die zur Friesengasse hinaus gingen. Eine Türe führte nach links zur Schlafkammer. Sie war so schmal, dass die zwei Betten hintereinander stehen mussten, und hatte nur ein Fenster. Die Wände waren in einem intensiven Blau gestrichen. Man sagte, die Wanzen flüchteten vor dieser Farbe. Man sah die Spuren vom Rauchgas der Petroleumlampe. Der Zylinder wurde an die Wand gehalten und die Tierchen verbrannten, wenn sie an der Wand hoch krabbelten und in den Zylinder fielen. Neben der Küche gab es zum Hof hin noch eine kleine Kammer. Wie die Familie mit vier Kindern unter diesen Umständen lebte, wie mein Vater und seine Geschwister hier aufwuchsen, ist heute schwer vorstellbar. In meiner Kinderzeit lebte der Großvater allein in der Wohnung. Seine Frau, meine Oma Elisabeth, war 1939 verstorben. An sie habe ich keine Erinnerungen. In der Wohnung war alles sauber und gepflegt, es gab kein Ungeziefer mehr. Es roch ganz intensiv nach Obst: Großvater bewahrte in Schränken und Schubfächern Äpfel und Birnen aus seinem Garten in Löbtau auf.
Über dem Wohnzimmertisch hing eine Gaslampe mit einem Glühstrumpf, den ein gewisser Auer erfunden hatte. Immer wieder warnte der Opa uns, diesen Glühstrumpf im kalten Zustand ja nicht zu berühren, dann fiele er sofort auseinander und werde zu Asche. An einer Art Waagebalken hingen an der Lampe mit grünem Schirm Ketten mit zwei Buchstaben A und Z. In der Schule hatte ich unterdessen gelernt, dies bedeutet „Auf“ und „Zu“.
Großvater besaß schon ein Radio. Es stand auf dem Schrank. Da es aber keinen elektrischen Strom gab, waren zwei Batterien nötig, eine größere Anodenbatterie und ein Akku für die Röhrenheizung. Schon 1923 hatte er als technische Neuerung einen Detektorempfänger benutzt. Man kratzte mit einer Nadel auf dem Kristall und hörte dann aus dem Kopfhörer ein schwaches Signal des örtlichen Rundfunksenders vom Hauptpostamt auf dem Postplatz.
Auf einem kleinen runden Tisch stand ein Aquarium. Ein einsamer Goldfisch schwamm darin herum. Das Becken wirkte wie ein Vergrößerungsglas, seine Augen wurden riesengroß, wenn ich ganz nah heran ging. Am Fenster hing ein Vogelbauer mit einem Kanarienvogel. Das waren Motive wie in den Bildern von Carl Spitzweg. Die Friesengassse war sehr schmal. Man sah gegenüber in die Bürofenster der Kreishauptmannschaft.
Die Wäsche wurde zum Trocknen auf einer Leine über den Hof gezogen. Manchmal hielten die Klammern nicht fest genug und ein Wäschestück landete auf dem Drahtgitter, das über den winzigen Hof gespannt war. Es roch dort oft intensiv nach geröstetem Kaffee, denn im Nebenhaus befand sich die Kaffeerösterei Noack. Zur Landhausstraße hin gab es noch drei Häuser mit Geschäften im Erdgeschoss. Ein Grünwarengeschäft hatte seine Auslagen vor dem Schaufenster auf dem Fußweg stehen. Beim Vorübergehen sah ich einmal, wie eine Ratte durch die Kisten lief.
Einmal nahm mich mein Großvater mit in den Keller. Die Geschichte, die er mir erzählte, war sehr phantastisch. Da unten wäre ein kleiner See mit einem weißen Schwan darauf. Noch heute sehe ich manchmal in meiner Vorstellung den weißen Schwan auf der dunklen Wasserfläche schwimmen. Ein Gang würde sogar bis unter die Frauenkirche führen. Er meinte wohl die sogenannten Kellerdurchbrüche, die von Haus zu Haus als Luftschutzmaßnahme angelegt worden waren und durch die man bei einer Zerstörung des Hauses in den nächsten Keller flüchten konnte. Wie alle Gebäude in der Umgebung fiel auch das Haus Friesengasse 1 am 13. Februar 1945 mit all seinen Bewohnern den Bomben zum Opfer. Großvater hätte sich auch nicht retten können, in dieser Nacht war er jedoch nicht zu Hause. Er war als Luftschutzwart in der Elektrofirma Siebmann auf der Wachsbleichstraße in Friedrichstadt eingesetzt. So blieb er am Leben.
Es war für ihn schwer, eine neue Unterkunft zu finden. Er wohnte in Mickten zur Untermiete. Seinen Kleingarten an der Fröbelstraße in Löbtau hat er noch lange behalten. Er pflanzte auch Obstbäume bei Bekannten, die er von weit her mit dem Handwagen holte.

Als er alt geworden war, wohnte er viele Jahre im Elsa-Fenske- Heim. Ich besuchte ihn dort hin und wieder. Auf den Trümmern der Umgebung, seinen Rittergütern, wie er sagte, sammelte er Kräuter, die er trocknete, um daraus Tee zu bereiten. 35 verschiedene Kräuter ergaben einen heilkräftigen Tee. Am 13. Mai 1962 starb er im Alter von 90 Jahren. Er hat es nie verwunden, seinen Sohn Ernst, meinen Vater, 1946 verloren zu haben. Er war stolz auf ihn, hatte sich mein Vater doch aus den einfachsten Verhältnissen, in denen er aufgewachsen war, zu einer beachtlichen Stellung emporgearbeitet.
In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann erfahren Sie mehr über den Vater und die Mutter von Ernst Hirsch.
Das vorangegangene Kapitel über die schlesischen Vorfahren von Ernst Hirsch können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.
In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.